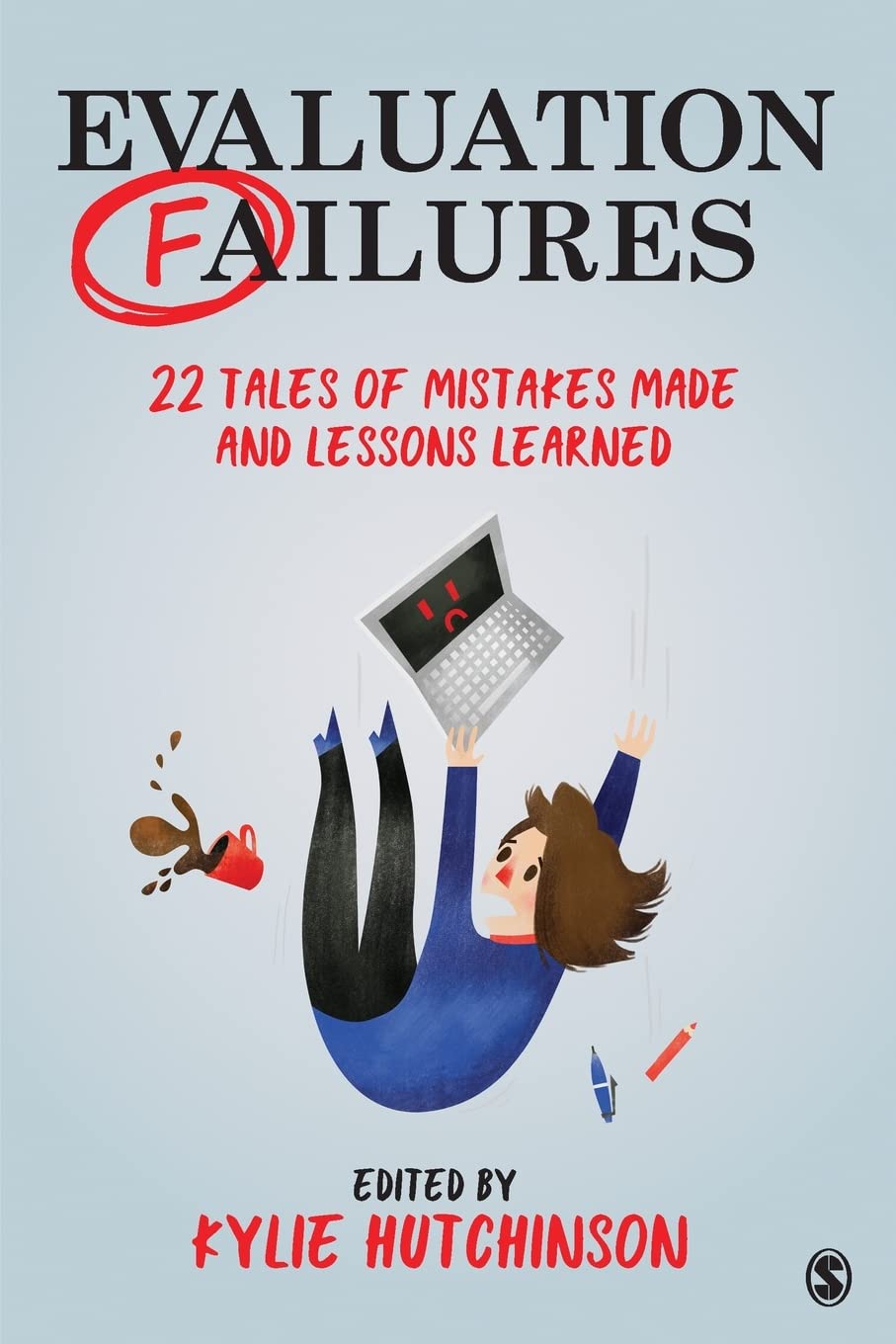Die Kunst des Scheiterns in der Evaluation
Ein Interview mit Kylie Hutchinson
Im professionellen Kontext gilt Scheitern häufig als Tabu – dabei hat jede*r von uns schon einmal Misserfolge erlebt. Aber was, wenn wir diese Erfahrungen nicht als Niederlagen betrachten, sondern als zentrale Lernmomente auf dem Weg der professionellen (Weiter-)Entwicklung?
Kylie Hutchinson, renommierte Evaluatorin und Trainerin für Evaluation aus Kanada, lebt genau diese Perspektive. In ihrem Buch "Evaluation Failures - 22 Tales of Mistakes Made and Lessons Learned" erzählen sie und noch 21 weitere Kolleginnen und Kollegen ganz offen, welche „Fehler“ ihnen beim Evaluieren unterlaufen sind - und was sie daraus gelernt haben.
Für den PME-Blog hat Evelyn Funk sie zu ihrem Buch interviewt.
Das Gespräch ist nicht nur ein Plädoyer für mehr Offenheit und Authentizität in der Evaluation, sondern auch eine Ermutigung für alle, die ihre Ängste überwinden und wertvolle „Lessons learnt“ mit anderen teilen möchten. Lasst uns gemeinsam dem Tabu des Scheiterns den Kampf ansagen und dabei vielleicht sogar hier und da über uns selbst lachen!

Evelyn Funk: Vielen Dank, liebe Kylie, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst! Ich bin erst vor kurzem auf dein Buch gestoßen und fand es super interessant. Als ich anfing zu lesen, dachte ich „Es muss so verdammt schwierig gewesen sein, all diese Menschen zu finden, die sich öffnen und ihre Geschichten erzählen.“ Und dann schreibst du aber schon in der Einleitung, dass es „schockierend leicht“ war, Geschichten des Scheiterns zu sammeln. Wie erklärst du dir diese Offenheit deiner Kolleg*innen?
Kylie Hutchinson: Es gibt ja das berühmte Sprichwort, dass die Zeit alle Wunden heilt. Wenn gerade erst ein Misserfolg passiert ist, ist es erst einmal ganz schrecklich, vor allem, wenn einem die Arbeit wirklich wichtig ist. Ich dachte oft nach so einem Misserfolg, ich könnte niemals mit jemandem darüber reden. Dann habe ich erst mal mit meinem Mann eine Flasche Wein getrunken. Und mit der Zeit ging es dann doch und ich konnte darüber sprechen. Je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass selbst ich als sehr erfahrene Evaluator*in immer noch Fehler mache. Und so dachte ich, wenn das bei mir der Fall war, dann gibt es da draußen eine Menge sehr wichtiger Lektionen, die andere Evaluator*innen gelernt haben. Wäre es nicht großartig, diese Lektionen ans Tageslicht zu bringen, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen? Ich habe mich mit meiner Anfrage für das Buch also bewusst an bekannte Evaluator*innen gewandt, weil ich den Leuten zeigen wollte, dass es keine Rolle spielt, ob man Stephanie Evergreen oder Michael Quinn Patton heißt. Dass auch sie Fehler gemacht haben. Und um das Scheitern zu normalisieren. Nur zwei Leute haben abgelehnt, weil sie keine Zeit hatten. Alle anderen, die ich angefragt habe, waren dabei und sagten: "Oh mein Gott, ja, ich MUSS dir etwas erzählen, aber das ist ziemlich pikant…“
Evelyn: Du hättest ja auch eine kleine Forschung machen können und das Ganze als Artikel veröffentlichen können. Warum hast du dich für das Format „Sammelband mit persönlichen Geschichten“ entschieden?
Kylie: Wir Menschen lernen aus Geschichten. Die Erzähler*innen in meinem Buch erzählen ihre Geschichte, und die Lesenden werden sich daran erinnern. Und: Ein wissenschaftlicher Artikel oder ein Lehrbuch wären nicht annähernd so unterhaltsam gewesen. Das war nämlich auch eines meiner Ziele: Ich wollte unterhalten. Ich bin kein großer Fan von Lehrbüchern. Ich finde sie unglaublich trocken und langweilig. Ich wollte bewusst etwas Unterhaltsames schreiben, das die Leute einfach in die Hand nehmen und gerne lesen, ohne sich durchzuquälen.
Evelyn: Man fiebert auch wirklich mit den Protagonist*innen mit. Man spürt beim Lesen an manchen Stellen beispielsweise großen Stress und Angst…
Kylie: Genau! Die Leute schickten mir ihre Entwürfe und ich habe beim Lesen so oft gedacht: „Oh, du armes Ding…“
Evelyn: Ich persönlich finde es echt schwer, über Misserfolge zu sprechen. Mich schreckt die Vorstellung ab, dass ich als unprofessionell wahrgenommen werden könnte. Hast du einen Rat für Menschen wie mich, wie wir diese Angst überwinden und offener über eigene Fehler und Misserfolge sprechen können?
"Anfangs war mir die Geschichte so peinlich, aber sechs Jahre später dachte ich: 'Ja, weißt du, wir alle machen mal Fehler. Aber wenn ich es kann, kannst du es auch richtig machen. Und wenn ich es zugeben kann, dann kannst du es auch zugeben. Und sieh mal, ich mache das vor 500 Leuten, und die Welt bricht nicht zusammen.'"
Kylie Hutchinson
Kylie: Zunächst einmal denke ich, dass wir Evaluato*rinnen viele unserer kleineren Fehler gut für uns behalten können, weil die Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht unbedingt merken, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Sonst sollten wir dazu stehen. Das ist aber schwer, wenn es in der Organisation keine entsprechende Kultur gibt. Wir nennen das eine Lernkultur oder eine Bewertungskultur oder eine Kultur des Scheiterns, in der das Scheitern gewissermaßen gefeiert wird: „Hey Leute, ich habe Mist gebaut, und das habe ich daraus gelernt!“ Ich selbst hatte ein paar aus meiner Sicht wirklich spektakuläre Misserfolge. Beim ersten habe ich eine Weile gebraucht, bis ich darüber sprechen konnte. Etwa fünf, sechs Jahre später habe ich auf einer internationalen Konferenz eine Keynote über diesen Misserfolg gehalten, und das war gut. Anfangs war mir die Geschichte so peinlich, aber sechs Jahre später dachte ich: „Ja, weißt du, wir alle machen mal Fehler. Aber wenn ich es kann, kannst du es auch. Und wenn ich es zugeben kann, dann kannst du es auch zugeben. Und sieh mal, ich mache das vor 500 Leuten, und die Welt bricht nicht zusammen.“
Evelyn: Das Sprechen über Misserfolge ist also fast schon ein Teil deines professionellen Rollenverständnisses?
Kylie: Ja! Wenn ich beispielsweise Trainings gebe, erzähle ich viele solcher Geschichten, weil sie unterhaltsam sind und sie fesseln. Aber ich zeige auch meine Authentizität. Ich denke, dass ist ein großer Teil meiner professionellen Persönlichkeit als Evaluatorin, besonders wenn ich eine Keynote halte oder ein Buch schreibe, oder wenn ich große Workshops bei der American Evaluation Association gebe. Ich bin völlig ehrlich zu den Leuten, bin völlig authentisch, denn ich habe schon genug mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen. Zum Beispiel gehe ich ganz offen damit um, dass ich vor 30 Jahren mal gut in Statistik war, dass ich es aber heute überhaupt nicht mehr kann. Ich bin da eine totale Versagerin – weil ich auch nie große quantitative Projekte übernommen habe. Man kann ja nicht in allem gut sein – das ist eine der Weisheiten, die mit dem Alter kommen.
Evelyn: Wir haben ja als Freiberuflerinnen recht viele Freiheiten. Ganz anders sieht es aus bei Menschen, die eng mit einer Organisation verbunden sind, in der eine offene Kommunikation über Fehler verpönt ist. Hast du einen Rat für Menschen in dieser Situation?
Kylie: Zunächst einmal kommt die Unfähigkeit, Misserfolge zu akzeptieren, nicht immer von innen. Oft kommt sie eher von außen, nämlich von den Steuerzahler*innen. Regierungen dürfen nicht versagen, sie dürfen keine Fehler machen. Es braucht schon sehr eifrige Manager*innen, wenn man in dem System eine andere Fehlerkultur etablieren möchte. Ich sympathisiere aber sehr mit Menschen, die in Behörden arbeiten. In Sambia war ich einmal kurz als interne Evaluatorin beschäftigt. Das war ein echter Augenöffner für mich. Vorher war ich es gewohnt, eine geschätzte Beraterin zu sein – und dann war ich plötzlich nicht mehr wichtig. Sie hatten einen Sitzungssaal mit einer Wand aus Milchglas, der unten durchsichtig war. Wenn ich vorbeiging und die Schuhe sah, dachte ich immer: „Ihr trefft euch alle, und ich sollte dabei sein, weil ich doch Informationen habe, die euch helfen können. Und ihr lasst mich nicht rein!“ Wir müssen also daran arbeiten, dass die Manager*innen zu Verfechtern von Evaluierung werden. Es ist knifflig, wenn wir als Evaluator*innen den Begriff „Misserfolg“ nicht verwenden können – außer vielleicht in extremen Fällen, wenn wir ein Statement setzen müssen. Ansonsten konzentrieren wir uns doch normalerweise auf Lösungen und Verbesserungen. In meinem Buch verwende ich bewusst positive Begriffe wie "Lessons learnt", die auch die Herausforderungen etwas leichter genießbar machen. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, wenn wir Manager*innen als Champions für Evaluation und eine gute Fehlerkultur weiterbilden, sodass sie zu Vorbildern für Mitarbeiter*innen werden.

Evelyn: Stimmt. Mir gefällt die Idee, unter Manager*innen Champions für Evaluation zu bestimmen, sehr gut. Wer älter ist, wer mehr Berufserfahrung hat, der kann vielleicht leichter über Misserfolge und Fehler sprechen.
"Du teilst dieses schreckliche, tiefe, dunkle, schmutzige Geheimnis und dann sagt dein Gegenüber: "Oh mein Gott, ich habe das Gleiche getan!'"
Kylie Hutchinson
Kylie: Ja, und ich garantiere dir, dass die selbst schon genug eigene Fehler gemacht haben. Den internen Evaluator*innen schlage ich vor, eine Person zu finden, der sie sich anvertrauen können. Und, wenn ihr einen Fehler gemacht habt: Wendet euch dann an diese Person. Ich selbst bin mit einigen meiner größeren Fehler nicht direkt zu anderen Evaluator*innen gerannt, weil ich mich auf keinen Fall blamieren wollte. Ich war noch nicht bereit dazu. Ich habe erst einmal mit Freund*innen gesprochen, um eine sofortige Therapie, Trost und eine Perspektive zu bekommen. Mit der Zeit war ich dann eher bereit, mich anderen Evaluator*innen mitzuteilen. Und weißt du, was passiert ist? Du teilst dieses schreckliche, tiefe, dunkle, schmutzige Geheimnis und dann sagt dein Gegenüber: "Oh mein Gott, ich habe das Gleiche getan!“ Ich habe bestimmte Dinge fünf Jahre oder länger mit mir herumgetragen, weil ich dachte, ich wäre die Einzige, die so etwas tut. Ich dachte wirklich, ich wäre die Einzige. Und das ist einfach nicht wahr.
Evelyn: Du hast deine Geschichten ja nicht nur mit Freund*innen und Kolleg*innen geteilt, sondern sogar in einer Keynote über dein eigenes Scheitern gesprochen! Ich glaube, von so einer Offenheit sind wir in Deutschland insgesamt noch weit entfernt.

Kylie: Gespräche über das Scheitern müssen ja nicht unbedingt in der großen Öffentlichkeit stattfinden. Einmal im Jahr treffe ich mich zum Beispiel zum Mittagessen mit einigen Kolleg*innen, die ich im Laufe der Jahre kennen gelernt habe. Im Restaurant bestellen wir uns ein Glas Wein, und dann sagt jemand: „Die Kuppel des Schweigens senkt sich herab.“ Und dann tauschen wir uns vertrauensvoll aus. Jemand fragt: „Was soll ich in dieser Situation tun?“ Oder erzählt „Ihr glaubt nicht, was ich letzte Woche getan habe“. Es ist informell, und es ist unglaublich tröstlich. Wir nennen es nicht Evaluations-Lunch, sondern Evaluations-Therapie. Es gibt aber auch ein formelleres Format mit dem Titel „Fail Forward“. Und ich denke, die Verbindung dieser beiden Wörter ist wirklich sehr wichtig. Sie gibt einen Kontext vor, in dem das Scheitern gefeiert wird und in dem es im Kern ums Lernen geht. Am Ende ist man klüger, weil man etwas durchdacht hat und etwas daraus mitnimmt, und es bestimmt beim nächsten Mal besser macht. Und, wie gesagt, mit der Zeit tut es nicht mehr so weh, und irgendwann ist es vielleicht sogar eine lustige Geschichte und man kann über sich selbst lachen.
Evelyn: Welchen Ratschlag hättest du rückblickend als junge Evaluator*in gerne in Bezug auf das Scheitern gehört?
"Scheitern ist eine der besten beruflichen Weiterbildungen, die man je ungewollt machen kann."
Kylie Hutchinson
Kylie: Ich denke, Scheitern ist eine der besten beruflichen Weiterbildungen, die man je ungewollt machen kann. Man sollte akzeptieren, dass man immer wieder scheitern wird und sich auf das Lernen konzentrieren. Außerdem kann man versuchen, eine Art Mentor*in zu finden, die/der mehr Erfahrung hat, mit der/dem man über Dinge reden kann, um vielleicht auch einige dieser Misserfolge zu verhindern. Als ich zum ersten Mal in diesem Bereich tätig war, war meine Mentorin eine sehr erfahrene Frau. Ich habe zunächst eine Menge gelernt, indem ich einfach mit ihr gearbeitet habe. Und als ich dann auf eigene Faust loszog, hatte ich bald eine sehr schwierige Situation mit einem Kunden. Ich rief sie an und sie gab mir ganz präzise Ratschläge, wie ich mit diesem bestimmten Kunden umgehen sollte. Ich schrieb jedes einzelne Wort mit. Ich selbst hatte einfach nicht die Erfahrung, um zu wissen, was ich in dieser Situation tun sollte. Und so war es unglaublich hilfreich, dass ich mich an diese Person wenden konnte. Denn wenn wir einen Fehler machen, neigen wir doch oft dazu, ihn in unseren Köpfen viel katastrophaler darzustellen, als er ist. Es ist also großartig, eine objektivere Perspektive darauf zu bekommen. Und es ist toll, bestätigt zu werden: „Oh, mir würde es auch so gehen.“ Oder „ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan.“. Das relativiert alles. Ich möchte all den angehenden Evaluator*innen da draußen eine große virtuelle Umarmung geben, denn, ja, auf eurem Weg werden Stolpersteine sein, aber sie werden euch zu viel besseren Evaluator*innen machen, als ihr es jetzt seid.
Evelyn: Ich wünschte, wir hätten in Deutschland ein richtiges Mentoring-Programm für die Evaluation. Hier haben die Leute haben entweder Glück, weil sie schon jemanden kennen, oder sie bemühen sich um Anschluss in Netzwerken.
Kylie: Ich würde den Leuten raten, sich erst einmal zu überlegen, wen man als Mentor*in haben möchte. Dann sollte man nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und fragen „Würden Sie mein Mentor sein?“ Denn das klingt direkt nach mehr Arbeit, als manche Leute vielleicht machen wollen. Man kann ja mit einer Frage einsteigen: „Ich habe dieses Problem und frage mich, ob Sie mir helfen können?“ Das wird eine Tür öffnen. Denn wer will einem jungen Menschen nicht helfen!? Wer will nicht, dass man ihn um Rat fragt? Wenn jemand zu mir kommt und mich um Rat fragt, dann sage ich: "Oh mein Gott, danke. Ich fühle mich so geehrt, dass Sie zu mir kommen und mich darum bitten!“ Ich würde der Person eine halbe Stunde meiner Zeit schenken. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen: „Wissen Sie was? Rufen Sie mich jederzeit an.“ Ja, das wird eine Tür öffnen.
Evelyn: Vielen Dank, das klingt nach einer super Strategie, die ich unbedingt weiterempfehlen werde. Damit ist unsere Zeit leider auch schon rum – ich danke dir sehr für das Gespräch!
Kylie: Sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn du demnächst mal über einen Misserfolg sprechen möchtest, meld dich gerne!
Zum Abschluss: Kylies Geschichte vom Scheitern mit einer Systems Map
Evelyn: Magst du mir zum Abschluss noch eine Geschichte aus deiner Evaluations-Praxis erzählen, in der du selbst einmal gescheitert bist?
Kylie: Gerne! Es ist schon eine Weile her. Ich habe damals in einem Projekt gearbeitet, bei dem ich einen Beirat in der Evaluation unterstützt habe. Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass wir es mit einem sehr komplexen Gegenstand zu tun hatten. Ich wollte den Beirat dabei unterstützen, zu verstehen, wie komplex das System war. Also machte ich mich an die Arbeit. Ich recherchierte über System-Mapping und verbrachte zwei Tage damit, eine Systems Map zu erstellen. Ich dachte, das ist die exzellenteste Systems Map auf der ganzen Welt. Alle Teile fügten sich zusammen, alles machte Sinn. Ich war so aufgeregt.
Ich habe die Map dann schön formatiert, ausgedruckt, und beim nächsten Meeting jedem Beiratsmitglied auf den Platz gelegt. Sie kamen in den Raum, sahen sich die Ausdrucke an, und ignorierten sie irgendwie. Ich habe meinen Vortrag gehalten und die Systems Map darin ausführlich erklärt. Also wie alle Elemente zusammenhängen und so weiter. Am Ende habe ich gefragt: “Haben Sie Fragen dazu?” Totenstille. Ich habe gewartet. Dann habe ich Suggestivfragen gestellt. Die Beiratsmitglieder saßen da wie die Rehe im Scheinwerferlicht. Sie waren komplett auf mich fokussiert und ich habe es einfach nicht geschafft, dass sie auf die Systems Map schauen. Nach endloser Stille hat irgendjemand vorgeschlagen, dass ich die Inhalte aus der Map doch in eine Tabelle übertragen könnte. Ich hab mich wieder hingesetzt, und sie gingen zum nächsten Punkt der Tagesordnung über. Es war furchtbar.
Einen Monat später trafen wir uns wieder und ich habe dieses Mal meine Map als großes Poster an die Wand gehängt in der Erwartung, dass die Teilnehmer*innen schon beim Reinkommen begeistern schauen und sich darüber austauschen werden.
Aber wieder haben sie es einfach vollständig ignoriert.
Als ich später darüber nachgedacht habe, ging mir irgendwann auf, dass meine Systems Map gut war. Es war auch egal, ob ich sie klein oder groß ausgedruckt habe. Der eigentliche Wert der Karte bestand aber darin, wie ich sie entwickelt hatte! Es ging nicht um das Produkt, sondern um den Prozess. Und den hatte ich leider ganz alleine durchlaufen, anstatt die Anderen einzubinden.
Mein Ansehen bei dieser Gruppe war schon vor diesem Vorfall nicht das Beste. Die Beiratsmitglieder waren alle Ärzte und hatten Vorurteile gegenüber Menschen, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen. Nachdem ich dann, aus ihrer Sicht, so ein blödes Ding mit Punkten und Pfeilen an die Wand gehängt hatte, musste ich echt kämpfen, um meine Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Um ehrlich zu sein bin ich mir nicht sicher, ob mir das jemals gelungen ist...